
Entgegen der Annahme ist Innovation kein kreativer Zufall, sondern das Ergebnis eines disziplinierten Ingenieurprozesses, den jedes deutsche Unternehmen meistern kann.
- Der Schlüssel liegt in der „Beidhändigkeit“: das bestehende Geschäft effizient optimieren und gleichzeitig systematisch neue Geschäftsfelder erkunden.
- Statt die Konkurrenz frontal anzugreifen, schafft echte Wertinnovation neue Märkte und macht Wettbewerber irrelevant.
Empfehlung: Beginnen Sie damit, Innovation nicht als ungreifbares Kulturprojekt, sondern als einen strukturierten Geschäftsprozess zu behandeln, der sich messen und optimieren lässt.
Viele Führungskräfte im deutschen Mittelstand kennen das Gefühl: Man arbeitet hart daran, Produkte zu perfektionieren und Prozesse zu optimieren, doch am Horizont tauchen plötzlich Wettbewerber mit radikal neuen Ideen auf, die ganze Märkte umkrempeln. Die Reaktion darauf ist oft hektisch: Es werden Brainstorming-Meetings anberaumt, bunte Haftnotizen an Wände geklebt und externe Berater für teure Kreativ-Workshops engagiert. Man hofft auf den einen genialen Geistesblitz, der das eigene Unternehmen rettet. Doch diese Jagd nach dem Zufallstreffer ist nicht nur ineffizient, sondern auch zutiefst frustrierend.
Die landläufige Meinung, Innovation sei ein unkontrollierbarer, fast mystischer Akt der Kreativität, ist eines der grössten Missverständnisse der modernen Unternehmensführung. Sie verleitet dazu, auf Inspiration zu warten, anstatt die Bedingungen für ihren Erfolg systematisch zu schaffen. Was wäre, wenn der Weg zu bahnbrechenden Neuerungen weniger mit kreativem Chaos und mehr mit präziser Ingenieurskunst zu tun hätte? Was, wenn man Innovation wie einen Fertigungsprozess gestalten könnte: wiederholbar, messbar und tief in der Unternehmens-DNA verankert?
Die Wahrheit ist, dass nachhaltige Innovation kein Glücksspiel ist. Sie ist das Ergebnis einer strategischen Entscheidung und eines disziplinierten Systems. Es geht darum, eine „Innovations-Ingenieurskunst“ zu entwickeln, die es einem Unternehmen erlaubt, seine Kernkompetenzen zu nutzen und gleichzeitig gezielt Neuland zu betreten. Dieser Artikel demystifiziert diesen Prozess. Er zeigt, wie Sie aufhören, auf die zündende Idee zu hoffen, und stattdessen eine verlässliche Maschine bauen, die kontinuierlich wertvolle Innovationen hervorbringt.
Um Innovation von einem Zufallsprodukt in einen verlässlichen Prozess zu verwandeln, müssen wir die verschiedenen Ebenen und Strategien verstehen, die dahinterstecken. Dieser Leitfaden führt Sie systematisch durch die entscheidenden Phasen, von der strategischen Ausrichtung bis zur praktischen Umsetzung im Unternehmensalltag.
Sommaire: Innovation als systematischen Unternehmensprozess gestalten
- Das Schiff verbessern oder ein neues bauen? Warum Ihr Unternehmen beides beherrschen muss
- Die Kunst der Differenzierung: Wie Sie aufhören, die Konkurrenz zu schlagen, und sie stattdessen irrelevant machen
- Die Innovations-Goldmine in Ihrem Unternehmen: Wie Sie das kreative Potenzial Ihrer Mitarbeiter an vorderster Front heben
- Wenn der Service zum Produkt wird: Wie Sie sich durch ein unvergessliches Kundenerlebnis von der Konkurrenz abheben
- Das Problem lösen oder die Lösung finden? Welcher Innovationspfad für Ihr Projekt der richtige ist
- Frontalangriff oder neue Gewässer entdecken? Welche Kampfstrategie für Ihr Unternehmen die intelligentere ist
- Die Garagen-Falle: Warum eine brillante Erfindung oft ein wertloses Produkt ist
- Jenseits des Hypes: Wie man den wahren Reifegrad einer technologischen Innovation erkennt
Das Schiff verbessern oder ein neues bauen? Warum Ihr Unternehmen beides beherrschen muss
Das zentrale Dilemma vieler etablierter Unternehmen liegt in einer falschen Entweder-oder-Frage: Sollen wir unsere Ressourcen darauf verwenden, unser bestehendes Geschäft (das „Schiff“) zu optimieren, oder sollen wir alles auf die Entwicklung völlig neuer Geschäftsmodelle (ein „neues Schiff“) setzen? Die Antwort der modernen Innovationsforschung lautet: Sie müssen beides tun. Dieses Prinzip wird als organisationale Ambidextrie (Beidhändigkeit) bezeichnet. Es beschreibt die Fähigkeit einer Organisation, gleichzeitig das Kerngeschäft effizient zu managen (Exploitation) und radikal neue Ideen zu erforschen (Exploration).
Deutsche Unternehmen, insbesondere die sogenannten Hidden Champions, sind Weltmeister in der Exploitation. Sie perfektionieren Produkte und Prozesse über Jahrzehnte und sichern sich so ihre Marktführerschaft. Dies wird durch beeindruckende Zahlen untermauert: Fast 50% der weltweit circa 3.400 Hidden Champions kommen aus Deutschland und sind ein Paradebeispiel für erfolgreiche Nischenoptimierung. Die Gefahr besteht jedoch darin, durch diese Fokussierung disruptive Marktveränderungen zu übersehen. Die reine Perfektionierung des Bestehenden schützt nicht davor, dass das Geschäftsmodell selbst überflüssig wird.
Die Kunst der Innovations-Ingenieurskunst besteht darin, die Exploration zu systematisieren. Das bedeutet, einen geschützten Raum für Experimente zu schaffen, der nicht den gleichen Effizienzkennzahlen des Kerngeschäfts unterliegt. Dies kann durch separate Innovationseinheiten, Kooperationen mit Forschungseinrichtungen wie den Fraunhofer-Instituten oder die Nutzung spezifischer Fördermittel geschehen. Ein konkretes Beispiel ist das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM). Wie die neue ZIM-Förderrichtlinie zeigt, werden gezielt Projekte unterstützt, die es dem deutschen Mittelstand ermöglichen, aus guten Ideen marktfähige Produkte zu entwickeln, ohne das operative Budget zu belasten. So wird das Risiko der Exploration minimiert und die Entwicklung des „neuen Schiffs“ finanziell abgesichert, während das alte weiterhin profitabel segelt.
Die Kunst der Differenzierung: Wie Sie aufhören, die Konkurrenz zu schlagen, und sie stattdessen irrelevant machen
In den meisten Branchen gleicht der Wettbewerb einem blutigen Grabenkampf in einem „roten Ozean“. Unternehmen kämpfen um die gleichen Kunden, unterbieten sich bei Preisen und kopieren die Merkmale der Konkurrenz. Das Ergebnis ist ein zermürbender Verdrängungswettbewerb mit sinkenden Margen. Die Blue-Ocean-Strategie bietet einen Ausweg: Statt im roten Ozean zu kämpfen, schafft man einen neuen, unberührten Markt – einen „blauen Ozean“ – in dem es keinen Wettbewerb gibt. Dies gelingt durch Wertinnovation: die gleichzeitige Steigerung des Kundennutzens und die Senkung der Kosten.
Das Ziel ist nicht, besser zu sein als die Konkurrenz; das Ziel ist, die Konkurrenz irrelevant zu machen, indem man die Spielregeln der Branche neu schreibt. Man analysiert, welche Faktoren, die die Branche als selbstverständlich ansieht, für den Kunden tatsächlich keinen Wert schaffen und eliminiert sie. Gleichzeitig werden neue Wertfaktoren geschaffen, die bisher niemand angeboten hat.
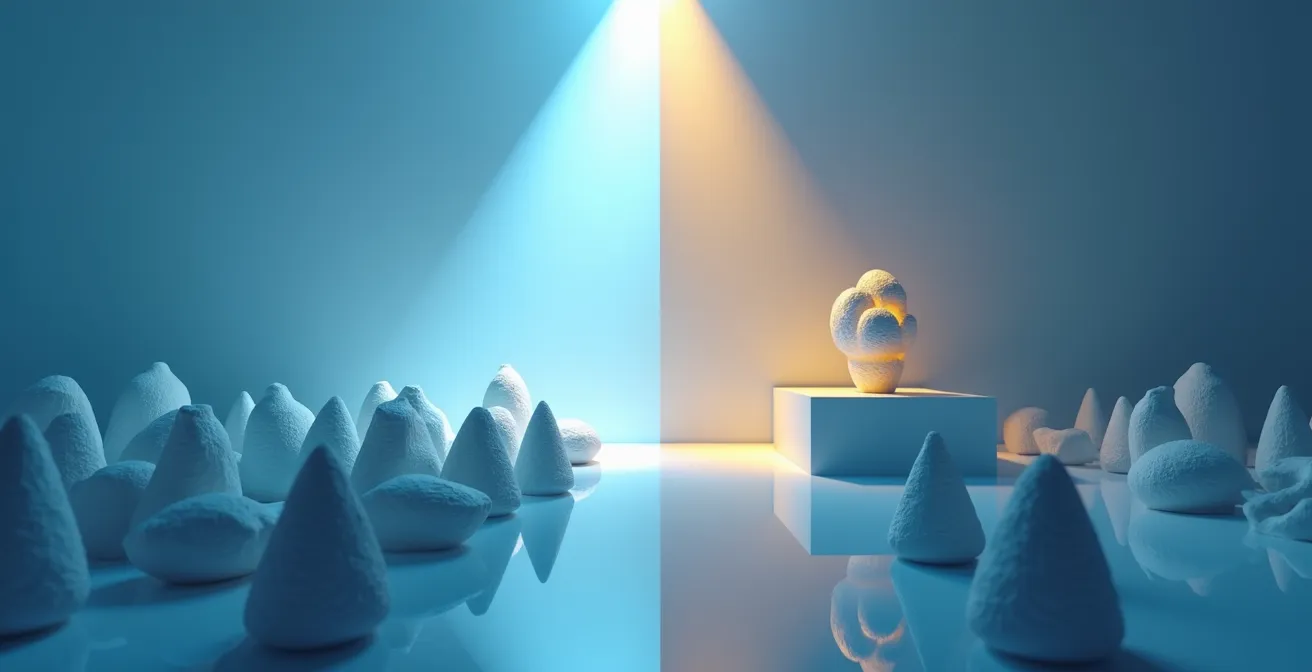
Wie dieses Konzept zeigt, geht es darum, aus der Masse der identischen Angebote auszubrechen und einen eigenen, unbesetzten Raum zu schaffen. Für deutsche Unternehmen liegt hier eine besondere Chance. Statt nur über den Preis zu konkurrieren, können sie ihre traditionellen Stärken – Qualität, Ingenieurskunst und Zuverlässigkeit – nutzen, um einzigartige Wertangebote zu schaffen. Ein blauer Ozean kann beispielsweise durch die Kombination eines Produkts mit einem unschlagbaren Service, durch ein Geschäftsmodell, das auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft setzt, oder durch die Garantie höchster Datensicherheit gemäss der DSGVO geschaffen werden. Diese Faktoren sind für viele Kunden heute wichtiger als der reine Preis und für internationale Wettbewerber oft schwer zu kopieren.
Die Innovations-Goldmine in Ihrem Unternehmen: Wie Sie das kreative Potenzial Ihrer Mitarbeiter an vorderster Front heben
Die wertvollsten Ideen für Innovationen schlummern oft nicht in den Vorstandsetagen, sondern direkt an der Front: bei den Mitarbeitern im Vertrieb, im Kundenservice oder in der Produktion. Diese Frontlinien-Innovatoren erleben täglich die Probleme der Kunden, die Schwachstellen der Produkte und die Ineffizienzen der Prozesse. Dieses Wissen ist eine wahre Goldmine, die in vielen deutschen Unternehmen ungenutzt bleibt. Das traditionelle Betriebliche Vorschlagswesen (BVW) mit seinem anonymen Briefkasten und langsamen Prozessen ist längst überholt und demotiviert mehr, als es nützt.
Eine moderne Innovations-Ingenieurskunst macht aus passiven Ideengebern aktive Mitgestalter. Es geht darum, einen systematischen Prozess für das Ideenmanagement zu etablieren, der schnell, transparent und wertschätzend ist. Denn es ist eine Tatsache, dass Unternehmen mit aktivem Innovationsmanagement ihre Effizienz um bis zu 30% steigern und eine höhere Mitarbeiterbindung aufweisen. Die Mitarbeiter fühlen sich ernst genommen und sehen, dass ihre Vorschläge tatsächlich etwas bewirken.
Der Wandel von einem passiven Vorschlagswesen zu einem agilen Ideenmanagement erfordert strukturelle Anpassungen. Es geht nicht nur darum, eine digitale Plattform einzuführen, sondern auch darum, Freiräume zu schaffen. Modelle wie die „10%-Zeit“, in der Mitarbeiter einen Teil ihrer Arbeitszeit für eigene Projekte nutzen können, haben sich als äusserst wirksam erwiesen. Der Fokus der Erfolgsmessung muss sich dabei verschieben: Nicht die schiere Anzahl der eingereichten Ideen ist entscheidend, sondern die Umsetzungsquote. Eine hohe Umsetzungsquote signalisiert den Mitarbeitern, dass ihr Engagement wertgeschätzt wird und reale Veränderungen bewirkt.
Ihr Plan zur Aktivierung der Frontlinien-Innovatoren
- Digitale Ideenplattform einführen: Ersetzen Sie den Papier-Briefkasten durch ein transparentes Tool, auf dem Ideen diskutiert und bewertet werden können.
- Innovationszeiten einräumen: Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, einen festen Anteil ihrer Arbeitszeit (z. B. 10%) für die Ausarbeitung eigener Ideen und Projekte zu nutzen.
- Betriebsrat als Co-Innovator einbinden: Definieren Sie gemeinsame Kennzahlen (KPIs) für den Innovationserfolg, um den Betriebsrat als Partner zu gewinnen.
- Azubi-Challenge starten: Führen Sie einen jährlichen Innovationswettbewerb speziell für Nachwuchstalente durch, um frühzeitig eine kreative Denkweise zu fördern.
- Erfolgsmessung anpassen: Machen Sie die Umsetzungsquote und den daraus resultierenden Nutzen zur primären Metrik, nicht die reine Anzahl eingereichter Ideen.
Wenn der Service zum Produkt wird: Wie Sie sich durch ein unvergessliches Kundenerlebnis von der Konkurrenz abheben
In einer Welt, in der Produkte immer austauschbarer werden, rückt das Kundenerlebnis (Customer Experience) ins Zentrum der Differenzierung. Innovation findet nicht mehr nur am Produkt selbst statt, sondern in der gesamten Dienstleistungskette, die es umgibt. Für viele Unternehmen wird der Service zum eigentlichen Produkt. Ein herausragendes Kundenerlebnis ist schwer zu kopieren und schafft eine emotionale Bindung, die weit über funktionale Merkmale hinausgeht. Es geht darum, nicht nur ein Problem zu lösen, sondern den gesamten Prozess für den Kunden so einfach, transparent und angenehm wie möglich zu gestalten.
Digitale Kanäle bieten hier enorme Möglichkeiten. Ein gutes Beispiel ist der Einsatz von Video-Marketing im Servicebereich. Anstatt komplizierte Anleitungen zu schreiben, können Unternehmen komplexe Dienstleistungen oder die Anwendung von Produkten in kurzen, verständlichen Videos erklären. Dies schafft nicht nur Klarheit, sondern baut auch Vertrauen durch sichtbare Expertise auf.
Fallbeispiel: YouTube-Marketing als Revolution im deutschen Kundenservice
Eine Analyse zeigt, dass deutsche Service-Unternehmen, die gezielt auf YouTube setzen, einen zwei- bis sechsmal höheren Return on Investment (ROI) erzielen als mit traditionellem TV-Marketing. Angesichts der Tatsache, dass 47% der deutschen Nutzer die Plattform täglich verwenden, eröffnet dies einen direkten Kanal zur Kundenbindung. Unternehmen nutzen dies, um als Experten wahrgenommen zu werden, komplexe Dienstleistungen verständlich zu machen und eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, bevor der erste persönliche Kontakt stattfindet.
Gerade in Deutschland spielt dabei der Aspekt der Datensicherheit eine entscheidende Rolle für das Vertrauen. Während viele internationale Anbieter Kundendaten als Handelsware betrachten, können deutsche Unternehmen hier einen klaren Wettbewerbsvorteil erzielen. Eine DIVSI-Studie belegt, dass 80% der Deutschen Bedenken beim Datenschutz zeigen. Ein Service, der nachweislich DSGVO-konform ist und die Datenhoheit des Kunden respektiert, ist daher keine lästige Pflicht, sondern eine wertvolle Innovation. Transparenz in den Service-Prozessen und die systematische Integration von Kundenfeedback (Co-Creation) sind weitere Bausteine, um einen Service zu schaffen, der als eigenständiges, überlegenes Produkt wahrgenommen wird.
Das Problem lösen oder die Lösung finden? Welcher Innovationspfad für Ihr Projekt der richtige ist
Nicht jede Innovation folgt dem gleichen Muster. In der Innovations-Ingenieurskunst unterscheidet man grundsätzlich zwei Pfade: den problemgetriebenen und den lösungsgetriebenen Ansatz. Die Entscheidung für den richtigen Pfad ist entscheidend für den Erfolg eines Projekts. Der problemgetriebene Pfad (Problem-Solution-Fit) ist der klassische Weg: Man identifiziert ein klares, dringendes Problem bei einer spezifischen Zielgruppe und entwickelt gezielt eine Lösung dafür. Dieser Ansatz ist fokussiert, risikoärmer und eignet sich hervorragend für inkrementelle Verbesserungen und die Optimierung bestehender Märkte.
Der lösungsgetriebene Pfad (Solution-Problem-Fit) ist hingegen oft der Ursprung disruptiver Innovationen. Hier steht am Anfang eine neue Technologie, eine neue Fähigkeit oder eine geniale Erfindung – eine Lösung, die noch auf der Suche nach dem passenden Problem ist. Man hat einen „Hammer“ und sucht nun nach den richtigen „Nägeln“. Dieser Weg ist riskanter und erfordert mehr Experimentierfreude, kann aber zu völlig neuen Märkten und Anwendungen führen, die vorher undenkbar waren.

Deutschland hat historisch eine Stärke in der Entwicklung exzellenter technologischer Lösungen. Die Herausforderung liegt jedoch oft in der anschliessenden Markt- und Anwendungsorientierung. Genau hier setzt eine kritische Analyse des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft an:
Deutschland ist stark in der Forschung, aber schwach in der Umsetzung. Innovation ist mehr als Transfer, sie ist immer auch ökonomisch erfolgreiche Umsetzung von neuen Ideen.
– Stifterverband, Deutschlands Innovationsdefizite
Diese Aussage bringt das Kernproblem auf den Punkt. Eine brillante technische Lösung ist wertlos, wenn sie kein relevantes Kundenproblem löst. Ein systematischer Innovationsprozess muss daher für beide Pfade Werkzeuge bereithalten. Für den problemgetriebenen Ansatz sind Methoden wie Kundeninterviews und „Jobs-to-be-Done“-Analysen entscheidend. Für den lösungsgetriebenen Ansatz benötigt man agile Prototyping-Zyklen und die Bereitschaft, schnell verschiedene Anwendungsfälle in unterschiedlichen Märkten zu testen, um das grösste Potenzial zu identifizieren.
Frontalangriff oder neue Gewässer entdecken? Welche Kampfstrategie für Ihr Unternehmen die intelligentere ist
Die strategische Entscheidung, wie man sich im Wettbewerb positioniert, ähnelt der Wahl eines Schlachtfeldes. Der Frontalangriff in einem bestehenden Markt („Roter Ozean“) bedeutet, sich direkt mit etablierten Konkurrenten zu messen. Dies erfordert massive Ressourcen, sei es durch Preiskämpfe, hohe Marketingbudgets oder den Versuch, ein leicht besseres Produkt anzubieten. Die Erfolgsaussichten sind oft gering und der Kampf ist zermürbend. Für die meisten deutschen Mittelständler ist dies ein aussichtsloses Unterfangen gegen globale Grosskonzerne.
Die intelligentere Strategie ist oft das Entdecken „neuer Gewässer“, also das Schaffen eines neuen Marktes oder die Besetzung einer hochspezialisierten Nische. Hierbei geht es nicht darum, den Konkurrenten zu schlagen, sondern ihn durch eine einzigartige Positionierung irrelevant zu machen. Dies ist die Domäne der deutschen Hidden Champions. Ihre Strategie basiert auf globaler Fokussierung auf eine enge Nische und dem Streben nach absoluter Technologieführerschaft in diesem Segment. Der Erfolg dieser Strategie ist beeindruckend: Schätzungen zufolge stammen rund 25% der deutschen Exporte von diesen Hidden Champions, die den Frontalangriff bewusst vermeiden.
Ein Vergleich der beiden Strategien zeigt die Überlegenheit des Nischenansatzes für den Mittelstand deutlich auf. Während ein Frontalangriff enorme Ressourcen bindet und eine geringe Erfolgswahrscheinlichkeit hat, ist die Erschliessung einer neuen Nische mit moderateren Mitteln und in kürzerer Zeit möglich.
| Strategie | Frontalangriff | Neue Gewässer (Nische) |
|---|---|---|
| Ressourcenbedarf | Sehr hoch | Moderat |
| Erfolgswahrscheinlichkeit | 20-30% | 60-70% |
| Zeithorizont | 3-5 Jahre | 1-2 Jahre |
| Wettbewerbsintensität | Extrem hoch | Gering bis moderat |
| Deutsche Erfolgsbeispiele | Selten (Aldi/Lidl) | Häufig (1.600+ Hidden Champions) |
Die Innovations-Ingenieurskunst besteht darin, systematisch nach solchen Nischen zu suchen. Dies kann durch die Kombination bestehender Technologien für eine neue Anwendung, die Bedienung einer bisher ignorierten Zielgruppe oder die Lösung eines sehr spezifischen Problems geschehen. Anstatt zu fragen „Wie können wir Marktanteile gewinnen?“, lautet die strategische Frage „Wo können wir einen Markt schaffen, in dem wir von Anfang an die Nummer eins sind?“.
Die Garagen-Falle: Warum eine brillante Erfindung oft ein wertloses Produkt ist
Deutschland ist ein Land der Dichter, Denker und vor allem der Tüftler. Die technische Brillanz und der Erfindergeist sind tief in der Kultur verwurzelt. Doch genau hier lauert die „Garagen-Falle“: die Verliebtheit in die eigene Erfindung bei gleichzeitiger Vernachlässigung des Marktes. Eine technologisch überlegene Lösung ist noch lange kein erfolgreiches Produkt. Wenn niemand bereit ist, für die Lösung zu bezahlen, oder wenn sie ein Problem löst, das niemand hat, bleibt sie eine wertlose Kuriosität – egal wie genial sie konstruiert ist.
Dieses Phänomen ist einer der Hauptgründe, warum Deutschland zwar in der Forschung Spitze ist, bei der Gründung von global erfolgreichen Tech-Unternehmen aber hinterherhinkt. Es mangelt nicht an Ideen, sondern oft am unternehmerischen Fokus auf die Marktvalidierung. Eine pointierte Analyse des Stifterverbands unterstreicht dieses Defizit:
In den USA liegt die Anzahl an Unicorns pro Kopf um den Faktor 4.5 über dem in Deutschland. Das muss uns zu denken geben.
– Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Deutschlands Innovationsdefizite
Um der Garagen-Falle zu entkommen, muss der Fokus von der Produktentwicklung auf die Kundenentwicklung gelenkt werden. Der Weg vom Tüftler zum Unternehmer erfordert einen Paradigmenwechsel: weg von der Frage „Können wir das bauen?“ hin zur Frage „Sollten wir das bauen – und wenn ja, für wen?“. Glücklicherweise gibt es in Deutschland ein wachsendes Ökosystem, das genau diesen Übergang unterstützt. Programme wie das EXIST-Gründerstipendium fördern Ausgründungen aus Universitäten, die Digital Hub Initiative bietet in 12 Städten kostenlose Beratung, und die Fraunhofer-Gesellschaft hilft bei der technischen Validierung. Der entscheidende Schritt ist jedoch, frühzeitig Marktkompetenz ins Team zu holen, zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit Business Angels, die nicht nur Kapital, sondern vor allem wertvolle Markterfahrung einbringen.
Das Wichtigste in Kürze
- Innovation ist ein Prozess, kein Zufall: Systematisches Vorgehen ist wichtiger als die Hoffnung auf einen Geistesblitz.
- Beidhändigkeit ist der Schlüssel: Erfolgreiche Unternehmen optimieren das Kerngeschäft (Exploitation) und erforschen gleichzeitig systematisch neue Geschäftsfelder (Exploration).
- Fokus auf Wertinnovation: Schaffen Sie neue Märkte, anstatt in überfüllten Märkten zu kämpfen. Machen Sie die Konkurrenz irrelevant, anstatt sie zu schlagen.
Jenseits des Hypes: Wie man den wahren Reifegrad einer technologischen Innovation erkennt
In der Welt der Innovation wimmelt es von Schlagwörtern und Hype-Zyklen: Künstliche Intelligenz, Blockchain, Quantencomputing. Für Führungskräfte ist es eine enorme Herausforderung, zwischen einer kurzlebigen Modeerscheinung und einer wirklich transformativen Technologie zu unterscheiden. Eine Fehlinvestition in eine unausgereifte Technologie kann Millionen kosten, während das Zögern bei einer Schlüsseltechnologie den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit bedeuten kann. Die systematische Bewertung des technologischen Reifegrads ist daher eine Kernkompetenz der Innovations-Ingenieurskunst.
Leider zeigen aktuelle Daten, dass Deutschland im internationalen Vergleich an Innovationsdynamik verliert. Der BDI-Innovationsindikator 2024 zeigt einen besorgniserregenden Abwärtstrend: Deutschland ist im Ranking der 35 führenden Volkswirtschaften auf Platz 12 gefallen. Dies liegt unter anderem an Defiziten bei der Digitalisierung und der zu langsamen Adaption neuer Technologien. Umso wichtiger ist es, einen klaren Prozess zur Technologiebewertung zu haben, anstatt dem nächsten Hype blind zu folgen.
Eine objektive Bewertung basiert nicht auf Medienberichten, sondern auf klaren Kriterien: Ist die Technologie skalierbar? Gibt es bereits erste erfolgreiche Anwendungsfälle ausserhalb des Labors? Wie hoch sind die Implementierungskosten und welche Kompetenzen werden im eigenen Unternehmen dafür benötigt? Institutionen wie die Fraunhofer-Gesellschaft, Europas grösste Organisation für angewandte Forschung, bieten hier wertvolle Unterstützung. Mit allein 406 Patentanmeldungen im Jahr 2023 ist sie ein Seismograph für technologische Entwicklungen. Sie bietet zudem Dienstleistungen wie den „Fraunhofer-Reifegrad-Check“ an, der Unternehmen eine unabhängige und fundierte Bewertung einer Technologie ermöglicht. Dies hilft, Investitionsentscheidungen auf eine solide, datenbasierte Grundlage zu stellen und sich nicht von kurzfristigen Trends blenden zu lassen.
Die Etablierung einer Innovations-Ingenieurskunst ist kein einmaliges Projekt, sondern eine kontinuierliche Reise. Es bedeutet, die Neugier eines Entdeckers mit der Disziplin eines Ingenieurs zu verbinden, um Innovation vom Reich des Zufalls in die Sphäre der strategischen Planung zu überführen. Beginnen Sie noch heute damit, Ihre Innovationsfähigkeit nicht als kreatives Glücksspiel, sondern als zentralen Geschäftsprozess zu analysieren und systematisch zu optimieren.