
Der wahre Wettbewerbsvorteil durch Technologie entsteht nicht durch Kostensenkung, sondern durch die strategische Neuausrichtung Ihres Geschäftsmodells.
- Identifizieren Sie Prozesse, die nicht nur Effizienz versprechen, sondern das Potenzial haben, wertvolle neue Daten-Assets zu generieren.
- Begreifen Sie Künstliche Intelligenz und Automatisierung als zugängliche Werkzeuge, um Kernprobleme zu lösen und neue Kundenerlebnisse zu schaffen.
Empfehlung: Beginnen Sie mit einem gezielten Audit derjenigen Abläufe, die die grösste strategische Hebelwirkung für Ihr Unternehmen versprechen, anstatt sich in isolierten IT-Projekten zu verlieren.
Die Begriffe „Digitale Transformation“, „Künstliche Intelligenz“ und „Automatisierung“ hallen durch die Gänge jedes Unternehmens. Für viele Geschäftsführer und Unternehmer im deutschen Mittelstand klingen sie jedoch oft mehr nach einer teuren Pflichtübung als nach einer greifbaren Chance. Die vorherrschende Meinung ist, dass es darum geht, Rechnungen schneller zu scannen, manuelle Arbeit zu reduzieren und vor allem Kosten zu senken. Dieser Fokus auf reine Effizienzsteigerung ist zwar verständlich, aber er greift zu kurz und verdeckt das eigentliche Potenzial.
Die Gefahr dieser Sichtweise liegt auf der Hand: Wer Technologie nur als Werkzeug zur Kostenoptimierung betrachtet, wird immer nur einen Schritt hinterherhinken. Man optimiert das, was bereits existiert, anstatt zu fragen, was durch Technologie überhaupt erst möglich wird. Was wäre, wenn der wahre strategische Hebel nicht in der inkrementellen Verbesserung liegt, sondern in der radikalen Neugestaltung von Wertschöpfung? Wenn es nicht darum geht, Ihr bestehendes Geschäft effizienter zu machen, sondern darum, Ihr Geschäft neu zu erfinden?
Dieser Artikel ist ein Plädoyer für einen Perspektivwechsel. Er zeigt Ihnen, wie Sie aufhören, Technologie als reines IT-Thema zu behandeln, und anfangen, sie als zentralen Baustein Ihrer Unternehmensstrategie zu begreifen. Wir werden uns ansehen, wie Sie die richtigen Ansatzpunkte für Automatisierung finden, warum KI auch für KMU zugänglich ist und wieso eine solide Datengrundlage der Schlüssel zu allem ist. Es geht darum, die Weichen für echtes, nachhaltiges Wachstum zu stellen und Technologie als den entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu nutzen, der sie sein kann.
Dieser Leitfaden bietet Ihnen einen strategischen Rahmen, um Technologie nicht nur zu implementieren, sondern sie zu einem integralen Bestandteil Ihrer Wertschöpfung zu machen. Entdecken Sie die entscheidenden Schritte, um von der reinen Kostenersparnis zur Schaffung dauerhafter Werte zu gelangen.
Inhalt: Technologie als strategischer Hebel zur Wertschöpfung
- Scannen Sie nur Rechnungen oder erfinden Sie Ihr Geschäft neu? Der wahre Sinn der Digitalen Transformation
- Wo fange ich an? Wie Sie die Prozesse mit dem grössten Automatisierungspotenzial in Ihrem Unternehmen identifizieren
- KI für alle: Wie Sie auch als kleines oder mittleres Unternehmen von Künstlicher Intelligenz profitieren können
- Müll rein, Müll raus: Warum Ihre KI-Strategie ohne eine solide Datengrundlage zum Scheitern verurteilt ist
- Selber bauen oder fertig kaufen? Die strategische Entscheidung, die über den Erfolg Ihrer Technologie-Initiative bestimmt
- Das Innovations-Audit: Ein 4-Stufen-Framework zur Bewertung neuer Technologien
- Das Problem lösen oder die Lösung finden? Welcher Innovationspfad für Ihr Projekt der richtige ist
- Jenseits des Hypes: Wie man den wahren Reifegrad einer technologischen Innovation erkennt
Scannen Sie nur Rechnungen oder erfinden Sie Ihr Geschäft neu? Der wahre Sinn der Digitalen Transformation
Die digitale Transformation wird oft missverstanden als die blosse Digitalisierung bestehender analoger Prozesse. Ein papierloses Büro oder eine automatisierte Rechnungsprüfung sind jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Sie repräsentieren Effizienz, aber nicht zwingend strategische Weiterentwicklung. Die wahre Transformation beginnt, wenn Unternehmen Technologie nutzen, um ihr grundlegendes Geschäftsmodell infrage zu stellen und neue Wertangebote zu schaffen. Es ist der Unterschied zwischen einem Taxiunternehmen, das eine App zur Buchung anbietet, und einem Unternehmen wie Uber, das das gesamte Konzept von Mobilität neu definiert hat.
Die Dringlichkeit dieses Wandels wird in Deutschland zunehmend erkannt. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie sehen 73 % der deutschen Unternehmen KI als wichtigste Zukunftstechnologie an. Doch die Umsetzung scheitert oft an der rein operativen Denkweise. Anstatt zu fragen: „Wie können wir Prozess X billiger machen?“, lautet die strategische Frage: „Welche neuen Dienstleistungen oder Produkte können wir anbieten, wenn wir Prozess X als Datenquelle nutzen?“ Jeder digitalisierte Prozess generiert Daten – und diese Daten sind der Rohstoff für neue Geschäftsmodelle, personalisierte Kundenerlebnisse und fundierte strategische Entscheidungen.
Initiativen wie die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) zeigen, dass der Zugang zu Hochtechnologie auch für den Mittelstand kein unüberwindbares Hindernis mehr sein muss. Die FMD agiert als Innovationsmotor für den Wirtschaftsstandort Deutschland, indem sie Know-how bündelt und Unternehmen einen niederschwelligen Zugang zu anwendungsorientierter Forschung ermöglicht. Solche Kooperationsmodelle helfen, die Lücke zwischen technologischer Vision und praktischer Umsetzung zu schliessen und den Fokus von reiner Kosteneffizienz auf echte Geschäftsmodell-Innovation zu lenken.
Wo fange ich an? Wie Sie die Prozesse mit dem grössten Automatisierungspotenzial in Ihrem Unternehmen identifizieren
Die Entscheidung, Prozesse zu automatisieren, ist gefallen. Doch wo beginnt man in einem komplexen Geflecht aus täglichen Abläufen? Die intuitive Antwort vieler Unternehmen ist, bei den offensichtlichsten Zeitfressern anzusetzen. Doch eine rein aufwandbasierte Priorisierung vernachlässigt oft den strategischen Wert. Ein Prozess ist nicht nur dann ein guter Kandidat für die Automatisierung, wenn er repetitiv ist, sondern vor allem dann, wenn seine Automatisierung neue strategische Möglichkeiten eröffnet.
Eine effektive Methode zur Identifizierung ist die Bewertung von Prozessen anhand von zwei Achsen: dem Automatisierungsgrad (Wie einfach lässt sich der Prozess standardisieren und automatisieren?) und der strategischen Hebelwirkung (Welchen neuen Wert schafft die Automatisierung über die reine Effizienz hinaus?). Prozesse mit hohem Potenzial sind oft solche, die repetitive, regelbasierte Tätigkeiten beinhalten und gleichzeitig wertvolle Daten generieren. Ein Beispiel ist die manuelle Erfassung von Kundenfeedback. Die Automatisierung spart nicht nur Zeit, sondern schafft auch einen strukturierten Datenschatz, der für die Produktentwicklung oder das Marketing Gold wert ist.

Die visuelle Analyse von Arbeitsabläufen hilft dabei, Engpässe und repetitive Schleifen zu erkennen, die sich für eine Automatisierung eignen. Der Fokus sollte dabei immer darauf liegen, nicht nur einen bestehenden Prozess zu beschleunigen, sondern zu überlegen, ob der Prozess selbst durch Technologie neu gestaltet werden kann. Ein strukturierter Ansatz ist dabei unerlässlich, um nicht willkürlich zu agieren.
Aktionsplan: Prozesse mit strategischem Potenzial identifizieren
- Volumen und Wiederholung prüfen: Identifizieren Sie Prozesse mit hohem monatlichen Volumen und einem hohen Anteil an repetitiven, regelbasierten Aufgaben, die keine komplexen menschlichen Entscheidungen erfordern.
- Strategische Hebelwirkung bewerten: Fragen Sie sich: Schafft die Automatisierung dieses Prozesses ein neues, wertvolles Daten-Asset für das Unternehmen? Verbessert sie das Kundenerlebnis direkt?
- Proof-of-Concept (PoC) durchführen: Starten Sie mit einem kleinen, überschaubaren Pilotprojekt. Viele RPA-Dienstleister bieten vergünstigte PoCs an, um den Nutzen risikofrei zu testen.
- Business Case erstellen: Nutzen Sie die Erfahrungen aus dem PoC, um einen fundierten Business Case zu entwickeln, der nicht nur Kosteneinsparungen, sondern auch den strategischen Mehrwert beziffert.
- Prioritäten für die Skalierung festlegen: Beginnen Sie mit den Prozessen, die den schnellsten und klarsten Mehrwert liefern (sogenannte „Quick Wins“), um interne Akzeptanz zu schaffen und die weitere Skalierung zu finanzieren.
KI für alle: Wie Sie auch als kleines oder mittleres Unternehmen von Künstlicher Intelligenz profitieren können
Das Akronym „KI“ erzeugt bei vielen mittelständischen Unternehmern immer noch Respekt, oft verbunden mit der Vorstellung von riesigen Investitionen und hochspezialisierten Entwicklerteams. Doch dieses Bild ist längst überholt. Künstliche Intelligenz ist demokratisiert worden und bietet gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) enorme Chancen. Die Frage ist nicht mehr *ob*, sondern *wie* KMU KI nutzen können. Aktuelle Zahlen belegen diesen Trend: Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, nutzen bereits 20 % der deutschen Unternehmen KI, ein deutlicher Anstieg binnen eines Jahres.
Die grössten Hürden für die Einführung von KI sind oft nicht finanzieller oder technischer Natur, sondern liegen im fehlenden Wissen und in Unsicherheiten. Eine Erhebung zeigt die Hauptgründe, warum Unternehmen zögern, KI einzusetzen:
| Hinderungsgrund | Anteil der Unternehmen |
|---|---|
| Fehlendes Wissen | 71% |
| Unklarheit über rechtliche Folgen | 58% |
| Datenschutz- und Privatsphäre-Bedenken | 53% |
| Datenqualität/Verfügbarkeit | 45% |
| Inkompatibilität mit bestehenden Systemen | 44% |
| Zu hohe Kosten | 28% |
Diese Tabelle macht deutlich: Das grösste Hindernis ist die Wissenslücke. Genau hier setzen in Deutschland gezielte Förderprogramme an. Die Mittelstand-Digital Zentren sind ein hervorragendes Beispiel. Sie fungieren als „One-Stop-Shop“ und bieten KMU Orientierung, Qualifizierung und zeigen anhand konkreter Demonstratoren die praktischen Möglichkeiten von KI auf. Durch den Ausbau des KI-Trainer-Programms wird diese Unterstützung weiter vertieft. Anstatt teure Eigenentwicklungen zu starten, können KMU auf erprobte KI-Lösungen als Service (SaaS) zurückgreifen – sei es für die intelligente Analyse von Kundendaten, die Vorhersage von Wartungsbedarf bei Maschinen oder die Automatisierung des Kundenservices durch Chatbots.
Müll rein, Müll raus: Warum Ihre KI-Strategie ohne eine solide Datengrundlage zum Scheitern verurteilt ist
Die leistungsfähigste Künstliche Intelligenz ist nutzlos, wenn sie mit schlechten, unvollständigen oder inkonsistenten Daten gefüttert wird. Das Prinzip „Garbage in, Garbage out“ ist in der Welt der KI ein unumstössliches Gesetz. Bevor Unternehmen also über komplexe Algorithmen nachdenken, müssen sie ihre Hausaufgaben machen: die Schaffung einer soliden, vertrauenswürdigen Datengrundlage. Dies ist kein technisches Detail, sondern eine strategische Notwendigkeit. In Deutschland haben laut einer Erhebung der Bundesnetzagentur bereits 37 % der Unternehmen Datenanalysen im Einsatz und liegen damit über dem EU-Durchschnitt – ein Zeichen dafür, dass die Bedeutung von Daten erkannt wird.
Eine solide Datengrundlage bedeutet, dass Daten nicht nur gesammelt, sondern auch systematisch aufbereitet, bereinigt und zentral verfügbar gemacht werden. Oft sind wertvolle Informationen in verschiedenen Abteilungen und inkompatiblen Systemen („Datensilos“) gefangen. Der erste Schritt einer jeden Datenstrategie ist daher die Inventarisierung und Konsolidierung dieser Datenquellen. Ziel ist es, ein „Single Source of Truth“ zu schaffen – eine zentrale, verlässliche Datenquelle, auf die sich alle Analysen und KI-Anwendungen stützen können. Erst wenn die Qualität und Verfügbarkeit der Daten gesichert ist, können sie zu einem echten Daten-Asset werden, das den Unternehmenswert steigert.
Diese strategische Vorarbeit ist die oft übersehene, aber entscheidende Voraussetzung für den Erfolg. Wie eine aktuelle Studie betont, ist die frühzeitige Einbeziehung dieser Entwicklungen entscheidend für den langfristigen Erfolg.
Unternehmen, die diese Entwicklungen frühzeitig in ihre Strategien einbeziehen, sichern sich langfristig Wettbewerbsvorteile und können sich in der globalisierten Wirtschaft behaupten.
– Grant Thornton Studie, B2B-Studie Digitale Transformation 2024
Selber bauen oder fertig kaufen? Die strategische Entscheidung, die über den Erfolg Ihrer Technologie-Initiative bestimmt
Sobald ein technologischer Bedarf identifiziert ist, stellt sich eine der fundamentalsten strategischen Fragen: Entwickeln wir eine eigene, massgeschneiderte Lösung („Build“) oder kaufen wir eine etablierte Standardsoftware am Markt („Buy“)? Diese Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen für Kosten, Zeit, Flexibilität und den Grad der Differenzierung. Es gibt keine pauschal richtige Antwort; die Wahl hängt von der strategischen Bedeutung des betreffenden Prozesses ab.
Die „Buy“-Option – der Kauf einer fertigen Software – ist oft der schnellere und kostengünstigere Weg. Er eignet sich hervorragend für Standardprozesse, die nicht zum Kerngeschäft gehören und keinen Wettbewerbsvorteil darstellen (z. B. Buchhaltung, Personalverwaltung). Man profitiert von der Expertise des Anbieters, regelmässigen Updates und einem verlässlichen Support. Der Nachteil ist eine geringere Flexibilität und die Abhängigkeit vom Anbieter. Die „Build“-Option hingegen ist sinnvoll, wenn es um strategische Kernprozesse geht, die Ihr Unternehmen einzigartig machen. Eine massgeschneiderte Lösung kann perfekt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten werden und einen echten, schwer kopierbaren Wettbewerbsvorteil schaffen. Dies erfordert jedoch erhebliche Ressourcen, Zeit und internes Know-how.
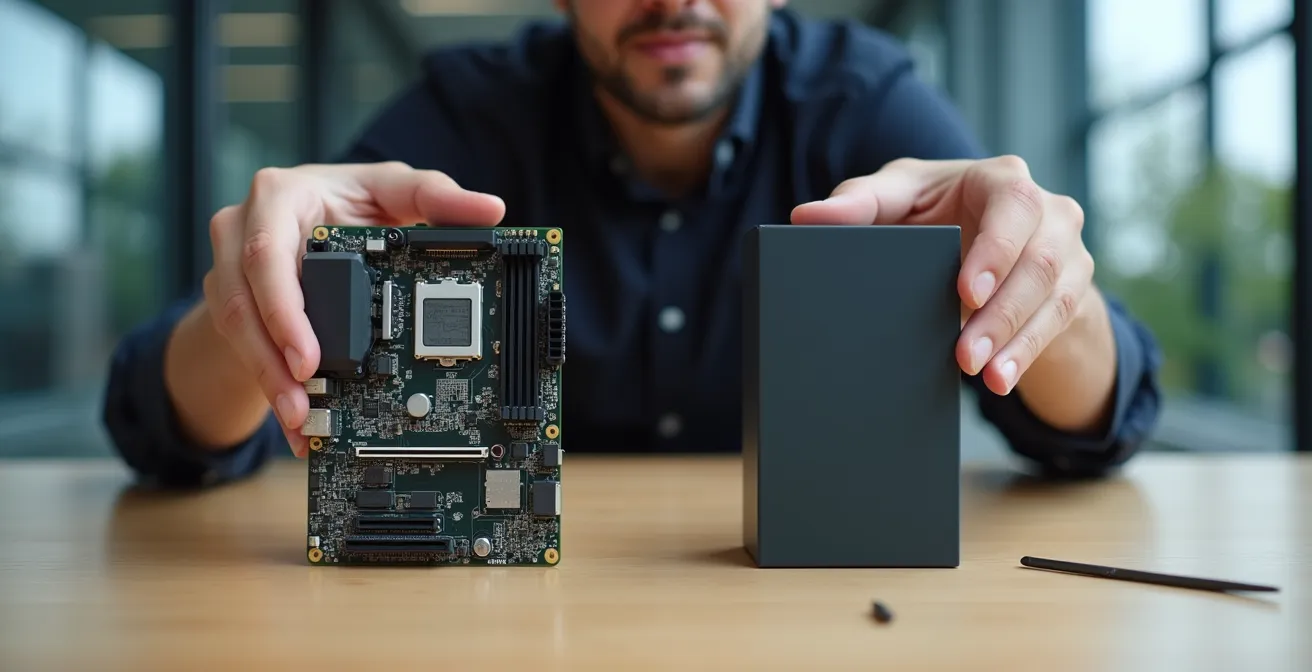
Viele erfolgreiche Automatisierungsprojekte im deutschen Mittelstand setzen auf einen pragmatischen „Buy“-Ansatz, um schnell Ergebnisse zu erzielen. So hat beispielsweise ein mittelständischer Grosshändler durch die Automatisierung der Webshop-Bestellabwicklung mit einer Standard-RPA-Lösung täglich mehrere Stunden eingespart und die Fehlerquote drastisch reduziert. Ein anderer Dienstleister verarbeitet monatlich 600 Rechnungen vollautomatisch und entlastet so seine Mitarbeiter für wertschöpfendere Tätigkeiten. Diese Beispiele zeigen, dass fertige Lösungen oft der effizienteste Weg sind, um klare Wettbewerbsvorteile zu realisieren.
Das Innovations-Audit: Ein 4-Stufen-Framework zur Bewertung neuer Technologien
In einer Welt voller technologischer Hypes ist die Fähigkeit, das Potenzial einer neuen Technologie realistisch einzuschätzen, ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Bevor Sie erhebliche Ressourcen investieren, ist ein systematisches Innovations-Audit unerlässlich. Dieser Prozess hilft Ihnen, Chancen von reinen Modeerscheinungen zu trennen und sicherzustellen, dass jede Technologie-Initiative auf Ihre strategischen Ziele einzahlt. Die Notwendigkeit hierfür ist gross, denn laut einer Bitkom-Umfrage wollen 74 % der deutschen Unternehmen in den kommenden Jahren in KI investieren. Ein strukturiertes Vorgehen verhindert, dass diese Investitionen im Sande verlaufen.
Ein solches Audit lässt sich in vier logische Stufen gliedern, die auf die spezifischen Bedürfnisse des deutschen Mittelstands zugeschnitten sind.
- Stufe 1: Bestandsaufnahme (Wo stehen wir?): Der erste Schritt ist eine ehrliche Analyse der eigenen digitalen Ausgangslage. Welche Prozesse sind bereits digitalisiert? Welche Daten sind verfügbar und in welcher Qualität? Welche Kompetenzen sind im Unternehmen vorhanden? Studien zeigen, dass hier oft eine grosse Lücke zwischen grösseren und kleineren Unternehmen klafft.
- Stufe 2: Strategische Passung (Wohin wollen wir?): Bewerten Sie die neue Technologie nicht isoliert, sondern im Kontext Ihrer Geschäftsstrategie. Welche konkreten Probleme könnte sie lösen? Welchen neuen Wert könnte sie schaffen? Eine Technologie ist nur dann wertvoll, wenn sie ein strategisches Ziel unterstützt, sei es die Erschliessung neuer Märkte, die Verbesserung des Kundenerlebnisses oder die Stärkung der eigenen Marktposition.
- Stufe 3: Machbarkeitsanalyse (Wie kommen wir dahin?): Prüfen Sie die praktische Umsetzbarkeit. Dies umfasst eine erste Schätzung der Kosten, des Zeitaufwands und der benötigten Ressourcen. Hier ist es oft sinnvoll, externe Expertise, z. B. von den bereits erwähnten Mittelstand-Digital Zentren, hinzuzuziehen, um eine realistische Einschätzung zu erhalten.
- Stufe 4: Pilotprojekt und Validierung (Funktioniert es für uns?): Statt sofort eine unternehmensweite Einführung zu planen, starten Sie mit einem kleinen, klar definierten Pilotprojekt (Proof-of-Concept). So können Sie die Technologie in Ihrem spezifischen Umfeld testen, lernen und den tatsächlichen Nutzen validieren, bevor Sie eine grosse Investition tätigen.
Dieser strukturierte Ansatz verwandelt vage Innovations-Ideen in ein konkretes, managebares Projekt mit klaren Zielen und Meilensteinen.
Das Problem lösen oder die Lösung finden? Welcher Innovationspfad für Ihr Projekt der richtige ist
Bei der technologischen Innovation gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Denkansätze. Der erste, der „Problem-First“-Ansatz, beginnt bei einem klar definierten, bestehenden Problem im Unternehmen oder beim Kunden und sucht gezielt nach der besten technologischen Lösung dafür. Der zweite, der „Solution-First“-Ansatz, startet mit einer faszinierenden neuen Technologie und erkundet, welche neuen Möglichkeiten oder Geschäftsmodelle sich damit schaffen lassen. Beide Pfade haben ihre Berechtigung, erfordern aber eine völlig unterschiedliche Vorgehensweise.
Der „Problem-First“-Pfad ist in der Regel risikoärmer und liefert schneller messbare Ergebnisse. Er eignet sich hervorragend für die Optimierung bestehender Prozesse und die inkrementelle Verbesserung des Kerngeschäfts. Die Herausforderung liegt darin, das Problem präzise zu definieren und nicht nur Symptome zu behandeln. Der „Solution-First“-Pfad ist explorativer und potenziell disruptiver. Er kann zu völlig neuen Geschäftsmodellen führen, birgt aber auch ein höheres Risiko des Scheiterns, wenn kein passender Markt für die neue Lösung gefunden wird. Dieser Pfad erfordert eine Kultur des Experimentierens und die Bereitschaft, auch Fehlschläge als Lernerfahrung zu akzeptieren.
Die positive Entwicklung des Digitalisierungsindex in Deutschland, der nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums von 108,1 Punkten im Vorjahr auf 113,6 Punkte im Jahr 2024 gestiegen ist, zeigt eine zunehmende Offenheit für beide Ansätze. Um jedoch nachhaltig erfolgreich zu sein, braucht es mehr als nur die Einführung einer neuen Technologie, wie Experten betonen.
Es reicht nicht, eine neue Technologie einzuführen. Um sich erfolgreich gegenüber Wettbewerbern zu behaupten, muss ein Unternehmen eine lernende Organisation sein.
– Prof. Dr. Thorsten Posselt, Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie
Eine lernende Organisation ist in der Lage, beide Innovationspfade je nach strategischem Kontext zu beschreiten. Sie kann sowohl bestehende Probleme effizient lösen als auch systematisch nach neuen Chancen suchen, die sich aus technologischen Durchbrüchen ergeben.
Das Wichtigste in Kürze
- Strategie vor Technologie: Echter Wettbewerbsvorteil entsteht nicht durch den Kauf von Software, sondern durch die Nutzung von Technologie zur Neugestaltung des Geschäftsmodells.
- Daten als Wertanlage: Betrachten Sie Daten nicht als Nebenprodukt, sondern als strategisches Asset, das aktiv aufgebaut und für neue Wertangebote genutzt werden muss.
- Gezielt starten, dann skalieren: Beginnen Sie nicht mit einem Mammutprojekt, sondern mit einem Innovations-Audit und einem kleinen, strategisch ausgewählten Pilotprojekt, um schnell zu lernen und den Nutzen zu validieren.
Jenseits des Hypes: Wie man den wahren Reifegrad einer technologischen Innovation erkennt
Der Markt für neue Technologien ist laut und voller Versprechungen. Jeder Anbieter preist seine Lösung als die nächste Revolution an. Für strategische Entscheider ist es jedoch unerlässlich, einen kühlen Kopf zu bewahren und den tatsächlichen Reifegrad einer Technologie objektiv zu bewerten. Nicht jede Innovation, die in der Tech-Presse gefeiert wird, ist bereits reif für den produktiven Einsatz in einem mittelständischen Unternehmen. Eine differenzierte Betrachtung der KI-Nutzung in verschiedenen deutschen Wirtschaftszweigen zeigt dies deutlich.
Die Daten der Bundesnetzagentur offenbaren, wie unterschiedlich weit die Adaption fortgeschritten ist. Während in der IT-Branche bereits die Mehrheit KI einsetzt, ist die Nutzung im Baugewerbe oder im verarbeitenden Gewerbe – dem Herz des deutschen Mittelstands – noch vergleichsweise gering.
| Wirtschaftszweig | KI-Nutzung Deutschland | EU-Durchschnitt |
|---|---|---|
| Information und Kommunikation | 61% | 49% |
| Handel und KFZ-Reparatur | 51% | k.A. |
| Verarbeitendes Gewerbe | 20% | 14% |
| Baugewerbe | 10% | 6% |
Diese Zahlen sind ein wichtiger Realitätscheck. Sie bedeuten nicht, dass KI für das Baugewerbe irrelevant ist, sondern dass die verfügbaren Lösungen möglicherweise noch nicht den spezifischen Anforderungen dieser Branche entsprechen oder die Implementierung komplexer ist. Der Reifegrad einer Technologie lässt sich anhand mehrerer Kriterien bewerten: technische Stabilität (Gibt es bekannte Kinderkrankheiten?), Verfügbarkeit von Fachkräften (Findet man Personal, das die Technologie beherrscht?), Existenz von Standards (Gibt es etablierte Protokolle und Schnittstellen?) und die Anzahl erfolgreicher Fallstudien in der eigenen Branche. Eine Technologie, die in einem Sektor bereits Standard ist, kann in einem anderen noch hochgradig experimentell sein.
Die strategische Aufgabe besteht darin, den „Sweet Spot“ zu finden: eine Technologie, die reif genug ist, um verlässlich zu funktionieren, aber noch neu genug, um einen echten Wettbewerbsvorteil zu bieten. Wer zu früh auf ein unausgereiftes Pferd setzt, riskiert hohe Kosten und Frustration. Wer zu lange wartet, verpasst den Anschluss.
Beginnen Sie nicht mit der Frage „Welche KI sollen wir kaufen?“, sondern mit der Frage: „Welches Kernproblem unseres Geschäftsmodells oder welches ungenutzte Potenzial kann Technologie für uns strategisch erschliessen?“. Die Antwort darauf ist Ihr erster und wichtigster Schritt zu einem echten, nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.